Unser Newsletter für Ihr Weiterkommen
IT, Personalentwicklung und Learning & Development
Jetzt anmeldenYou are using an outdated browser. Please update your browser for a better experience

Führungskräfte haben einen bevorzugten Führungsstil. Ob direktiv, laissez-faire oder empowernd: Jeder dieser Ansätze hat seine Vor- und Nachteile. Warum es für Führungskräfte dennoch sinnvoll ist, ihren eigenen Führungsstil zu reflektieren, welche verschiedenen Arten der Führung es gibt und welche Vorteile insbesondere die situative Führung mit sich bringt, erfahren Sie im Folgenden.
Wenn es um die verschiedenen Führungsstile geht, kann zwischen vier unterschiedlichen Arten unterschieden werden: direktiv, überzeugend, partizipativ und empowernd. Es ist dabei empfehlenswert, den eigenen Führungsstil an verschiedene Teams und die jeweiligen Umstände anzupassen.
Was sind jedoch die Vorteile davon, seinen individuellen Führungsstil zu kennen?
Sich über seinen Führungsstil Gedanken zu machen und verschiedene Führungstechniken und -modelle zu kennen hat den Vorteil, dass sich Führungskräfte mit den verschiedenen Möglichkeiten befassen, ihre Mitarbeitende zu motivieren und damit indirekt Ergebnisse zu beeinflussen. Dabei gibt es jedoch auch eine gesellschaftliche Herausforderung. Nicht jede:r kann auf die gleiche Weise geführt werden, und gerade jetzt müssen auch die Erwartungen der neuen Generationen berücksichtigt werden.
Lebensqualität am Arbeitsplatz, Autonomie, die Möglichkeit der Remote- und Homeoffice-Arbeit und nicht zuletzt die Frage nach dem Sinn: Führungskräfte müssen in der Lage sein, sich an Mitarbeitende und ihre verschiedenen Persönlichkeiten anzupassen, die vielfältig und heterogen sind. Damit einher geht auch die Fähigkeit der Führungskräfte, ihren Führungsstil an ihre jeweilige Umgebung anpassen zu können, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Wie bereits angesprochen können vier allgemeine Führungsstile unterschieden werden: empowernd, überzeugend, partizipativ und direktiv. Jede Führungskraft hat dabei einen bevorzugten Stil, der jedoch nicht in Stein gemeißelt ist. Um Mitarbeitende effektiv führen zu können, muss man zunächst sich selbst kennen. Mit anderen Worten: Eine Führungskraft muss wissen, wo sie steht.
Im Allgemeinen weiß jede Führungskraft intuitiv, welchen Führungsstil sie bevorzugt. Um sich des eigenen Führungsstils bewusster zu werden, können auch folgende Fragen hilfreich sein:
Wenn Sie mit einer Aufgabe betraut werden, neigen Sie eher dazu, Ergebnisse zu fordern oder legen Sie den Fokus eher auf die Qualität der Beziehungen innerhalb Ihres Teams?
Sehen Sie sich eher in einem Prozess der Zusammenarbeit oder eher in einer kontrollierenden Funktion? Hinter den vier Führungsstilen verbergen sich zwei unterschiedliche Ansätze. Der direktive und der partizipative Führungsstil sind Beispiele für Führungstypen, die ihren Fokus insgesamt stärker auf die Aufgabe und die zu erzielenden Ergebnisse ausrichten. Der überzeugende und der empowernde Stil konzentrieren sich dagegen auf den Weg zum Ziel, die Atmosphäre innerhalb des Teams und darauf, dem Team die Möglichkeit zu geben, seine Gedanken und Emotionen auszudrücken.
Absolut gesehen ist kein Stil besser als ein anderer. Statt der starren Befolgung eines bestimmten Führungsstils geht es vielmehr darum, die eigene Führung an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen zu können, da jeder seine eigenen Vor- und Nachteile hat.
Dieses vertikale Modell geht davon aus, dass die Führungskraft die Situation richtig einschätzen und am besten analysieren kann. Dieser Führungsstil hat den Vorteil, dass er schnelle Handlungsfähigkeit ermöglicht und ein Team schnell aufgestellt und zum Laufen gebracht werden kann. Nachteile dieses Führungsstils sind die Gefahr des Autoritarismus, mangelndes Zuhören und die fehlende Kompetenz, Aufgaben zu delegieren. Dieser Stil wird deshalb auch als autokratische oder autoritäre Führung bezeichnet.
Die überzeugende Führung zeichnet sich im Vergleich dazu durch die Fähigkeit aus, Überzeugungen zu kommunizieren und das Team dazu zu motivieren, sich diesen anzuschließen. Diese Führungskräfte sind im Allgemeinen sehr engagiert und können ihre Entscheidungen gut begründen. Sie hören ihren Mitarbeitenden zu, scheuen keine Konflikte und wollen durch Argumente überzeugen. Dabei kann es jedoch dazu kommen, dass die Zusammenarbeit ein wenig voreingenommen ist. Führungskräfte, die diesen Führungsstil verfolgen, können dazu neigen, Meinungen, die von ihrer eigenen abweichen, nicht zu berücksichtigen.
Diese Art der Führung ist eher horizontal ausgerichtet und fördert sowohl die Team- und Zusammenarbeit als auch die Kooperation. Entscheidungen werden gemeinsam getroffen, sodass keine untergeordnete Beziehung zwischen Führungskraft und Team entsteht. Der Vorteil dieses Führungsstils ist, dass er die Ansichten aller Beteiligten berücksichtigt und ihre Fähigkeiten optimal nutzt. Allerdings ist dieser Ansatz weniger geeignet, wenn es um die Bewältigung von Konflikten geht, da die Zusammenarbeit an ihre Grenzen stößt, wenn es darum geht, ein Element oder ein Team neu auszurichten.
Dieser auch als delegativ bezeichnete Führungsstil beruht auf der Vorstellung, dass jedes Teammitglied seinen genauen Aufgabenbereich kennt. Er wird manchmal auch als „Laissez-faire“-Führungsstil bezeichnet. Er funktioniert sehr gut in Umgebungen wie der Forschung oder in bestimmten IT-Berufen mit Expert:innen- oder Autonomie-Profilen. Die Herausforderung besteht allerdings darin, dass den Teams ein Rahmen fehlt. Sind die Umrisse der Aufgaben nicht richtig formalisiert, kann dies zu Missverständnissen oder Konflikten führen.
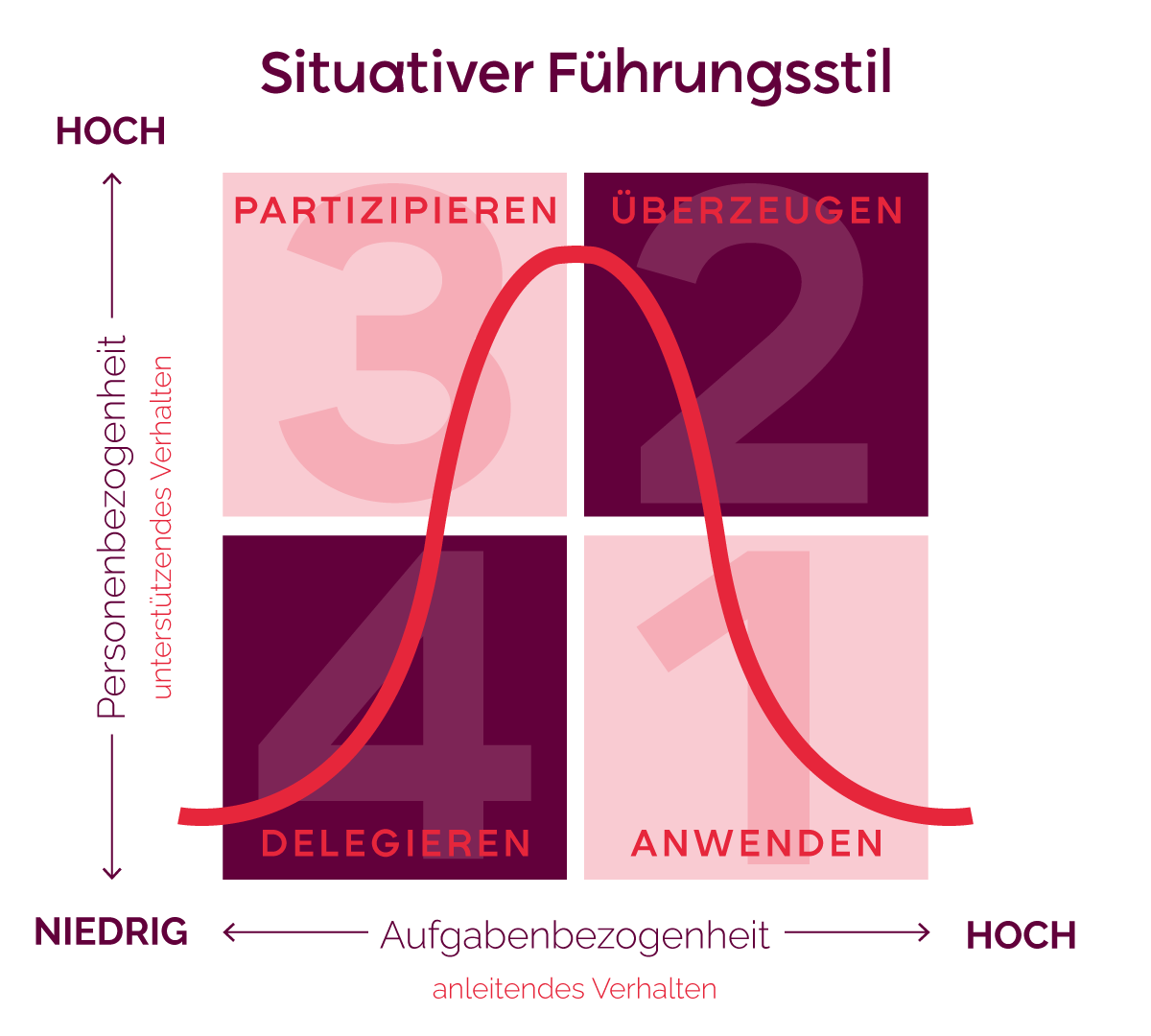
Jede Führungspersönlichkeit hat ihren individuellen Führungsstil und jede Situation kommt mit anderen Anforderungen einher. Es ist daher vorteilhaft, den eigenen Führungsstil an die individuelle Umgebung anzupassen und weiterzuentwickeln, wenn man die Herausforderungen, Anforderungen und Notwendigkeiten der jeweiligen Situation kennt.
Bei direktiver Führung erfolgt eine Anweisung oder Entscheidung ohne weitere Auseinandersetzungen oder Diskussionen, da sie sich durch eine gewisse Dringlichkeit auszeichnet. In gewissen Ausnahmesituationen kann das durchaus sinnvoll sein, etwa inmitten einer Krise oder für einen kurzen Zeitraum, etwa wenn ein neues Teammitglied angeleitet werden muss. Dennoch gilt es, potenzielle negative Auswirkungen zu bedenken. In einem stabilen oder gefestigten Umfeld kann sich direktive Führung schnell negativ auf die Motivation auswirken.
Der überzeugende Führungsstil wird hingegen wegen seiner Energie und seines Enthusiasmus geschätzt, die er erzeugt, wenn ein neues Projekt gestartet wird. Dieser Ansatz ist interessant, wenn eine Aufgabe über einen längeren Zeitraum hinweg durchgeführt werden soll, denn er gibt den Mitarbeitenden eine klare Ausrichtung und ein definiertes Ziel vor. Aufgrund des offenen und konstruktiven Umgangs mit Konflikten ist dieses Profil für komplexe Projekte geeignet.
Überzeugende Führung zeichnet sich durch eine aufgeschlossene Haltung gegenüber anderen Ideen sowie durch Überzeugungskraft aus. Doch auch dieser Ansatz hat seine Grenzen. In einer kritischen Situation, in der keine Zeit für Diskussionen oder aktives Zuhören bleibt, besteht die Gefahr, dass man sich in vielen verschiedenen Aufgaben verstrickt und wertvolle Zeit verliert.
In der täglichen Arbeit fördert die partizipative Führung vor allem die Kreativität. Sie ist ideal, um Menschen zur Zusammenarbeit zu bewegen, da sie die Visionen aller berücksichtigt und die individuellen Fähigkeiten optimal nutzt. Dieser Ansatz eignet sich besonders dann, wenn gemeinsam über ein neues Thema reflektiert werden soll.
Allerdings ist es manchmal schwierig, diesen Ansatz auf Dauer zu verfolgen. Wenn die Führungskraft dem Konsens die höchste Priorität einräumt, kann es hier an Durchsetzungsvermögen fehlen. Manchmal muss eine Führungskraft für ihre Perspektive einstehen, um eine Entscheidung zu treffen.
Schließlich ist empowernde Führung unerlässlich, wenn Führungskräfte mit Expert:innen zusammenarbeiten. Sie ist auch in allen Situationen nützlich, in denen Kreativität gefragt ist. Allerdings kann dieser Führungsansatz schnell zur Herausforderung werden, wenn beispielsweise im Projektmodus gearbeitet werden muss. Dieser Stil fördert eher den Individualismus als die Teamarbeit.
Die Idee, den individuellen Führungsstil an die jeweiligen Umstände anzupassen, ist nicht neu. Seit der weltweiten Pandemie ist sie jedoch eine Notwendigkeit. So lassen sich nicht nur Ergebnisse verbessern, sondern auch Talente anziehen, halten und langfristig binden.
Die Herausforderung bei der situativen Führung besteht darin, von einem Stil zum anderen zu wechseln und sich von der bevorzugten Arbeitsweise zu lösen. Dazu ist ein gewisses Maß an Agilität erforderlich, um alle verfügbaren Ressourcen effektiv nutzen zu können.
In der Praxis erfordert situative Führung deshalb vor allem ein Verständnis der eigenen Arbeitsweise, der jeweiligen Umstände sowie eine detaillierte Analyse des Teams, mit dem man zusammenarbeitet. Dabei sollten die Dringlichkeit der Situation, die erwarteten Ergebnisse, die Fristen sowie die Erwartungshaltungen analysiert und in die Überlegungen einbezogen werden. Was die Weiterentwicklung betrifft, so kann diese durch das Erlernen neuer Instrumente im Rahmen von Schulungen erreicht werden. Dadurch haben Führungskräfte die Möglichkeit, sich in der Praxis zu analysieren, zu reflektieren und neue Stile auszuprobieren. Zudem können sie sich mit Kolleg:innen über ihre Erfahrungen mit den verschiedenen Führungsstilen austauschen und gemeinsam Herausforderungen bewältigen.
Dieser Blogbeitrag wurde auf Grundlage eines Blogartikels der Cegos Group übersetzt und adaptiert. Den Originalbeitrag finden Sie hier: https://www.cegos.fr/ressources/mag/management/style-de-management-le-votre-est-il-efficace
Ein Fehler ist aufgetreten.